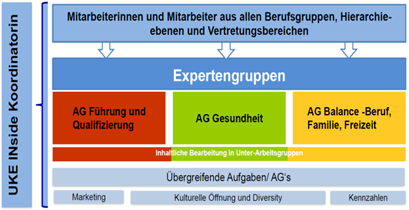Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im Produktlebenszyklus bewertet wird.
Das Universitätsklinikum Hamburg-EppendorfDie Produkte und Dienstleistungen des UKE sind universitäre Medizin, Forschung und Lehre. Um bei sämtlichen Leistungsinhalten und den unterstützenden Prozessen eine durchgängige Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte sicherzustellen, koordiniert die Vorstands-
Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement die Einhaltung der Grundlagen des UKE-Leitbildes.
Dieses
UKE-Konzernleitbild beschreibt aufbauend auf den drei Fundamenten „Wirtschaftlichkeit und Steuerung“, Infrastruktur“ und „Zusammenarbeit und Führung“ fünf tragende Säulen, die für das UKE einen eindeutigen Kompass für die Ausrichtung, Strategie und Entwicklung darstellen. Die Säule „Nachhaltiges und ökologisches Unternehmen“ ist seit 2014 die wesentliche Grundlage für die Stärkung ökologischer und nachhaltiger Unternehmenspolitik.
Im UKE ist bereits seit 2010 die Arbeitsgruppe „
Das grüne UKE“ mit berufsgruppen- und bereichsübergreifenden Themenfeldern zur Steigerung der Nachhaltigkeit am UKE tätig. Die langjährigen Aktivitäten und Initiativen aus der Arbeitsgruppe finden in der 2019 etablierten Vorstands-Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement ihre Fortsetzung. Die Schaffung einer eigens auf dieses Thema fokussierten Stabsstelle unterstreicht das Anliegen und die Ernsthaftigkeit des UKE die Nachhaltigkeit des Unternehmens langfristig zu steigern.
Die neue Stabsstelle agiert über die Grenzen der Zentren, Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften hinaus und ihre direkte Anbindung an den Vorstand sichert Unabhängigkeit sowie Durchschlagskraft bei der Umsetzung von Entscheidungen. Als Querschnittsfunktion stehen die Netzwerkarbeit und die Konsensfindung im Vordergrund. Auf dieser Basis ist gewährleistet, dass sich die Wirkung auf sämtliche Prozesse in den Kliniken, Instituten, Geschäftsbereichen, Tochtergesellschaften und im Dekanat zur Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation erstreckt.
Neben den energieeffizenzsteigernden Maßnahmen der technischen Dienstleistungsbereiche – das größte Projekt war der Aufbau eines Blockheizkraftwerkes mit Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (BHKW mit KWKK) im Jahr 2013 mit einer elektrischen Leistung von 2 MW – werden Potenziale zur Verbesserung der Nachhaltigkeit identifiziert, Projekte entwickelt und umgesetzt. Weiterhin fließen steigende Anforderungen, Qualifizierungskriterien und Vorgaben zur Nachhaltigkeit in sämtliche Beschaffungsvorgänge und externe Beauftragungen ein.
Viele Projekte wurden dauerhaft in Prozesse und permanente Systeme überführt, wie das Ideenmanagement mit dem Titel "
Mach mit", um eine Beteiligung der Mitarbeitenden und deren Akzeptanz sicherzustellen.
Das Projekt „digitale Patientenakte“, dient dem Ziel des papierlosen Krankenhauses. In der gastronomischen Tochtergesellschaft wird das
RECUP-Pfand- und -Mehrwegbecher-System genutzt und ausgebaut, welches deutschlandweit zum Einsatz kommt.
Ein konzernübergreifendes Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 sichert die kontinuierliche Weiterentwicklung der Energieeffizienz. Im Bereich der Logistik erfolgt auf dem Zentralgelände des UKE eine gebäudeübergreifende emissionsfreie Versorgung mit medizinischem Material und Verbrauchsartikeln über ein fahrerloses Transportsystem (FTS) sowie der Transport von Probenmaterial über eine Rohrpostanlage.
Als grundlegende Positionierung zur Nachhaltigkeit wird die Selbstverpflichtung zur Einhaltung des B.A.U.M.-Kodex für nachhaltiges Wirtschaften nach außen und innen gewahrt.
Einkaufs- und Beschaffungsrichtlinien
Das Thema Ökologie im Einkauf – als Schlüssel für eine nachhaltige Beschaffung – hat im UKE deutlich an Bedeutung gewonnen. Grundsätzlich erfolgen alle Einkaufspraktiken im UKE unter Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards in der gesamten Supply Chain. Fair Trade, also der Handel zu Weltmarktpreisen unter Einhaltung von internationalen Umwelt- und Sozialstandards, ist im UKE ein wesentlicher Aspekt bei der Beschaffung.
Eine systematische Integration von nachhaltigen und ökologischen Aspekten bei der Einkaufsentscheidung und Beschaffungsstrategie ist, soweit möglich, fester Bestandteil in der Beschaffung. Das UKE fördert durch den intensiven Austausch mit seinen Lieferanten, dass in neue, umweltschonende Produktionsverfahren investiert wird und bringt sich als Ideengeber entsprechend ein.
Selbstverständlich müssen auch ökologische und nachhaltige Produkte die wirtschaftlichen Kriterien und Anforderungen des UKE erfüllen. Doch schon heute sind diesbezüglich sinnvolle Produkte in vielen Fällen wettbewerbsfähig, wenn man den Gesamtprozess und die damit verbundenen Life Cycle Costs vergleicht. Kostensenkungen bei den eingesetzten Produkten können durch Minimierung von Materialeinsatz und Energieverbrauch erreicht werden. Beides trägt zur Umweltverträglichkeit bei und schont Ressourcen. Auch die Reduktion von Transport und Verkehr sowie die Minimierung von Abfällen und das Schließen von Kreisläufen schont die Umwelt und ermöglicht gleichzeitig weitere Einsparungen. Durch die Erhöhung des Einsatzes von erneuerbaren Ressourcen bei den zu beschaffenden Produkten können langfristig strategische Wettbewerbsvorteile entstehen.
Der Einkauf im UKE nutzt daher seine Hebelwirkung für eine nachhaltige Entwicklung, indem neben den klassischen Einkaufskriterien wie Preis, Qualität und Zuverlässigkeit auch neue „grüne“ Einkaufskriterien in der Beschaffungsentscheidung Berücksichtigung finden. Nicht jeder Artikel eignet sich für eine solche „grüne“-Bewertung. Hier müssen zum einen Aufwand und Nutzen einer solchen Bewertung in angemessenen Verhältnis stehen und zum anderen lassen sich Artikel zum Beispiel aufgrund von nicht ausreichender Produktinformation nur in Maßen bewerten.
Insbesondere der Bereich der medizinischen Verbrauchsartikel (Spritzen, Kanülen, Verbandsmaterial etc.) stellt eine umfassende und extrem vielfältige Produktgruppe im Klinikalltag des UKE dar. Diese Produkte werden überwiegend nach einmaligem Gebrauch in den Müll und entsorgt. Dies führt zu erheblichem Ressourcenverbrauch und zu Umweltbelastungen. Durch die dadurch erzwungene Mehrproduktion entstehen damit einhergehend vermehrt CO
2-Emissionen. Insbesondere hier wird der Einkauf des UKE künftig Projekte entwickeln, die eine Nachhaltigkeitsbewertung zulassen. Voraussetzung für solche umfassenden Analysen ist das Vorhandensein von entsprechenden Informationen über die Produkte. Bisher sind diese Informationen nicht vorhanden oder nur schwer von den Herstellern zu erhalten. Ein unterstützendes Element beim Einkauf ökologischer und nachhaltiger Produkte sind daher derzeit vor allem Öko- bzw. Nachhaltigkeitslabels von herstellerunabhängigen Organisationen (z. B.
Blauer Engel, EU-Umweltzeichen, EPEAT).
Das UKE ergänzt die Standard-Kriterien wie Zuverlässigkeit, Servicequalität oder Preistreue bei den Einkaufsentscheidungen mit weitergehenden sozialen Standards. Die Beachtung von Arbeits- und Menschenrechten ist hierbei ein ausschlaggebendes Kriterium. Das UKE hat sich verpflichtet, über Ergänzende Vertragsbedingungen (EVB) auf die Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen hinzuwirken.
Als Ergänzende Vertragsbedingungen zum zu vergebenden Auftrag muss der Bieter
Eigenerklärungen abgeben, die als vertragliche Nebenpflicht im Falle des Zuschlags Bestandteil des Vertrages sind. Der Lieferant verpflichtet sich darin, den Auftrag ausschließlich mit Waren auszuführen, die nachweislich unter Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen gewonnen oder hergestellt worden sind. Für den Verstoß gegen die vertraglichen Nebenpflichten nach diesem EVB-ILO bei der Ausführung des Auftrages werden damit Sanktionsmöglichkeiten für den Auftraggeber vertraglich vereinbart. Tariftreue und Mindestlohn, insbesondere bei Dienst- und Bauleistungen, sind Grundvoraussetzung für das UKE für eine Auftragsvergabe. Dies gilt auch für etwaige Unterauftragsnehmer.
Eine weitere Grundvoraussetzung ist, dass niedrige Preise für Dienstleistungen oder Produkte nicht auf zu niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden oder unsichere Arbeitsverhältnisse zurückzuführen sind.
Soziale Standards sind neben dem Umweltschutz eine wichtige Bewertungsgröße bei der Auswahl von Lieferanten und werden bei Ausschreibungen abgefragt. Eine Vielzahl der Lieferanten des UKE verfügen zudem bereits über systematische Zertifizierungen z. B. nach ISO 14001 oder ISO 9001.
Der Strategische Einkauf des UKE führt des Weiteren selbstständig Lieferantenaudits im In- und Ausland durch. Teil dieser Audits ist die Überprüfung der Einhaltung von Sicherheits- und Umweltvorschriften, Einhaltung von Arbeitssicherheit (auch Unterlieferanten), Gehälter auf landestypischem Niveau (auch Unterlieferanten) und die Sicherstellung der Vermeidung von Kinderarbeit.
Die Digitalisierung ist ein zentrales Ziel für Beschaffung und Supply Chain im UKE. Der überwiegende Teil der Prozesse erfolgen im UKE-Einkauf und der Supply Chain bereits papierlos. Weit mehr als 60 Prozent der eingehenden Rechnungen werden vollständig digital und papierlos verarbeitet. Im Zentrallager wird Robotertechnik eingesetzt, um die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden weiter zu erleichtern und die körperliche Belastung zu minimieren.
Zudem wird der Einkauf im UKE künftig Folgendes tun, um die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben:
- Etablierung eines „Life Cycle Thinking“ bei der Produktauswahl
- Beschaffung aller notwendigen Informationen für eine ökologische und nachhaltige Produktbewertung
- Soweit sinnvoll und möglich Verwendung von Mehrwegprodukten anstelle von Einwegartikeln
- Beachtung von Umwelt- und Nachhaltigkeitslabels bei der Lieferanten- und Produktauswahl
- Bewertung der eingesetzten Rohstoffe bei Produkten und Produktionsprozessen der Lieferanten
- Durchführung von Öko-Audits bei den Lieferanten
- Augenmerk auf soziale Mindeststandards in der gesamten Supply Chain
- Beachtung der Produkteignung zur Kreislaufwirtschaft
- Vermehrter Einsatz, soweit möglich und sinnvoll, von Produkten mit Recycling-Anteil
- Wenn wirtschaftlich vertretbar: „buy local“ – je näher desto besser
- Einführung von umweltintelligenten Prozessen im Einkauf und der gesamten Lieferkette
- Grundsätzlich nur umweltfreundliche Verpackungsarten
Die Unterstützung durch die Mitarbeitenden im UKE, der Partner und Lieferanten ist dabei unverzichtbar. Dabei wird Umweltschutz im Beschaffungswesen des UKE als große Chance zur Kostenreduktion verstanden.
Stärkung der Innovationskraft im UKE
Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 verknüpft die
MediGate GmbH, ein Unternehmen des UKE, die Interessen von Wissenschaftler:innen mit Fördermittelgebern und Industrie.
Mit ihrer Unterstützung in den Bereichen Drittmittelverträge, EU-Förderanträge und Verwertung des geistigen Eigentums trägt die MediGate maßgeblich dazu bei, UKE-Forschungsergebnisse aus dem Labor zum Wohle der Patient:innen in die Anwendung zu bringen.
MediGate bietet Wissenschaftler:innen des UKE sowie deren Partnern eine professionelle Unterstützung im Technologietransfer, in der Förderberatung und bei klinischen Studien.
Ziel ist die nachhaltige Stärkung der Wissenschaft und Forschung im UKE, zum einen durch Steigerung des Drittmittelaufkommens und zum anderen mittels der Verwertung des am UKE generierten geistigen Eigentums.
Dies wird in den folgenden fünf Bereichen geleistet:
- Vertragsmanagement Drittmittel
- Kalkulation und Controlling Klinischer Studien
- Nationale Forschungsförderung
- EU-Forschungsförderung
- Technologietransfer
Das Altonaer KinderkrankenhausFür das Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) gilt nicht das UKE-Leitbild, sondern die eigens definierte Vision, die als
„Stern des AKK“ mit seinen acht Einzelsäulen (Strategien) abgebildet wird. Der Stern ist das verbindende Symbol der einzelnen Strategien und dient dem AKK als Orientierungsgrundlage u. a. für sein nachhaltiges Handeln. Unter dem Aspekt des Innovations- und Produktmanagements sind insbesondere die Säulen „Blue Hospital“ sowie „Optimierung der Prozesse“ als besonders relevant anzusehen. Hinzu kommt für den sozialen Bereich der Nachhaltigkeit zusätzlich die tragende Säule „Innovationen und neue Behandlungsmethoden“. Dabei geht es darum, dass die wachsende Spezialisierung der Medizin eine fortlaufend bessere Versorgung der Patient:innen ermöglicht. Entscheidend für das AKK ist dabei die Zusammenarbeit der verschiedenen Spezialisten und Berufsgruppen, da nur interdisziplinär ganzheitliche Therapieansätze gelingen können. Dieses Konzept macht das AKK über die Stadtgrenzen hinaus attraktiv.